Herr Illi, erklären Sie uns doch zum Einstieg das Konzept der Kulturland-Genossenschaft.
Unsere Kulturland-Genossenschaft kauft Agrarflächen aus der Spekulation frei. Das heißt konkret: Wir kaufen Land und geben es Biolandwirt:innen mit eigentumsähnlicher Sicherheit zur Bewirtschaftung. Das ist eine neue Form der gemeinschaftlichen Landfinanzierung, bei der Bürger:innen zu Anteilseigner:innen werden. So entsteht ein neues Bündnis zwischen Bürger:innen und Höfen.
Was war Ihre Motivation, mit Ihrem Vorstandskollegen Dr. Titus Bahner Kulturland eG zu gründen?
Die Idee wurde geboren, weil in den vergangenen 15 Jahren die Agrarlandpreise durch die Decke gegangen sind. Der Kaufpreis hat sich durchschnittlich verdreifacht. Vor der KuIturland-Gründung habe ich den Demeter-Verband geleitet und war Berater für Demeter-Höfe. Es zeichnete sich schon damals ab, dass sich ökologische Landwirtschaftsbetriebe nach der Preisexplosion Land kaum mehr leisten können. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Wenn wir das jetzt nicht machen, passiert nichts. Frei nach dem Motto: Lass uns ein Zeichen setzen und lass uns einen Weg finden. Zwölf Jahre sind wir nun schon auf diesem Weg.
Wie kommen Sie an Interessent:innen?
Biolandwirt:innen melden sich aktiv bei uns. Meist liegt es daran, dass sie in existenzbedrohliche Situationen geraten, in denen sie Land verlieren würden. Dann schauen wir im ersten Schritt: Passen sie zu uns. Wir arbeiten nur mit Biobetrieben (etwa Bioland oder Demeter) zusammen. Die regionale Vermarktung ist darüber hinaus wichtig, damit wir Unterstützer:innen gewinnen können. Auch soziale Landwirtschaft z.B. mit Schulbauernhof oder solidarischen Landwirtschaft eignet sich gut (Anmerkung der Redaktion zur Definition Soziale Landwirtschaft:Verbraucher:innen auf lokaler Ebene kooperieren mit einem oder mehreren Partner-Landwirt:innen). Wenn das passt, machen wir viele Menschen aus dem Umfeld der Höfe zu Miteigentümer:innen. Kurz gesprochen: Nicht-Landwirt:innen übernehmen Verantwortung, damit dieser Hof weiterhin existieren kann.
Was sind die Motive der Investor:innen, bei Ihnen einzusteigen?
Primäres Interesse ist, die lokale, ökologische Landwirtschaft zu fördern. Es geht darum, die Regionalversorgung zu erhalten und Biodiversität zu fördern, aber auch, gemeinsam jungen Menschen den Einstieg in die Landwirtschaft überhaupt möglich zu machen.
Was ist die Mindestinvestition bei Ihnen und was bekommen Genoss:innen dafür?
Die Mindesteinlage ist 500 Euro. Es ist möglich, die Anteile für einen spezifischen Hof zu zeichnen. Unsere Mitglieder bekommen keine monetäre Rendite, aber eine hohe ideelle Rendite. Sie ermöglichen vielseitige ökologische Landwirtschaft und reiches ökologisches und soziales Leben auf den Höfen. Das ist der Return on Investment.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Etwas mehr als 2.600 Mitglieder haben wir und wir wachsen stark. Wir haben viele und auch größere Neuprojekte in ganz Deutschland. Weil die Kunden und Menschen der Region ihre Biohöfe erhalten und unterstützen möchten, bringt jeder Hof wieder neue Mitglieder mit. Um Ihnen einen Eindruck zu geben: Im Großraum Nürnberg (Hofgemeinschaft Vorderhaslach) haben 290 Genoss:innen mit einer Investitionssumme von etwas mehr als einer Million Euro 68 Hektar Land aus der Spekulation befreit. Dieses Land steht dem Demeter-Hof dauerhaft zu günstigen Bedingungen zur Verfügung.
Warum ist es gerade für die ökologische Landwirtschaft so wichtig, günstiges Ackerland zu bekommen? Gilt das nicht für alle Landwirte?

Natürlich hat die konventionelle Landwirtschaft dasselbe Problem mit steigenden Bodenpreisen. Sie können nur besser darauf reagieren, weil sie unter anderem nicht an ökologische Vorgaben der Biolandwirtschaft gebunden sind. Konventioneller Anbau kann schneller durch Intensivierung gesteigert werden. Die Erntemenge wird auf Kosten der Natur erhöht und kompensiert teilweise die gestiegenen Kosten. Bei nachhaltiger Landwirtschaft geht das nicht, das ist auch gut so. Bodenaufbau geht nur mit extensivem Ökolandbau und für Biodiversität sind extensive Wiesen und Weiden wichtig. Z.B. hängt vieles von auf der Weide liegenden Kuhfladen ab. Darin leben eine Vielzahl an Insekten, von ihnen leben Vögel und Fledermäuse. Diese Biodiversität bleibt bei der Intensivierung auf der Strecke. Geld, das bei Kulturland liegt, duftet also nach gesundem Boden.
Sie haben vor elf Jahren mit Kulturland begonnen. Was war ihr erstes Projekt und gab es Stolpersteine?
Zwei riesige Hürden tauchten damals auf. Wir durften als Genossenschaft gar nicht kaufen. Daher mussten wir unsere eigene Eigentumsform entwickeln. Wir gründen regionale Kommanditgesellschaften, bei denen die bewirtschaftenden Landwirt:innen Kommanditisten sind und die Kulturland eG der Komplementär. (Anm. d. Redaktion: Kommanditisten sind Teilhafter der KG und haften nicht privat, Komplementäre sind vollumfänglich mit der Einlage haftend). Ohne das wäre fast der erste Kauf des Luzernenhofs in Baden-Württemberg gescheitert.
Die zweite Hürde: Wie gewinnen wir Menschen, die uns Geld geben können und keine (monetäre) Rendite erwarten? Das erschien fast unmöglich, und dennoch hat es geklappt. Unsere Investor:innen geben sich “nur” mit einer ökologischen und sozialen Rendite zufrieden. In den vergangenen zwölf Jahren haben wir mit 13 Millionen Euro Investitionskapital 700 Hektar freikaufen können.
Was hat die Bodenpreise in die Höhe steigen lassen?
Zu den innerlandwirtschaftlichen sind auch außerlandwirtschaftliche Investor:innen eingestiegen. Auch die öffentliche Hand und Gemeinden buhlen um die Flächen. Sie zahlen hohe Preise, weil sie Bauland und Ausgleichsflächen für Infrastrukturprojekte benötigen. Auch Fotovoltaik und Biogas-Erzeugung benötigen Fläche. Es ist also eine klassische Verknappung entstanden, die den Preis in die Höhe getrieben hat. Die Ökolandwirtschaft droht dabei, auf der Strecke zu bleiben.
Was wünschen Sie sich von der Politik für eine tragfähige Biolandwirtschaft?
Der Landpreis muss an den Ertragswert des Bodens gekoppelt werden. Das traut sich aktuell niemand anzugehen. Auch der Bauernverband hat eigene Interessen, die nicht mit dieser Idee konform gehen, obwohl junge Landwirte von ihr profitieren würden. Wir benötigen Grundstücksverkehrsgesetze in den Ländern, die Ökolandbau und Gemeinschaftseigentum mitdenken (vgl. Kasten “Projekt mit Hürden”). Und der Einstieg von jungen Leuten in die Landwirtschaft muss viel stärker gefördert werden. Denken Sie nur, jedes Jahr hören etwa 3000 Höfe auf, und die verbleibenden werden immer größer und intensiver. Wir steuern sehenden Auges in die Katastrophe, wenn nichts passiert.
Herr Illi, vielen Dank für das Gespräch!
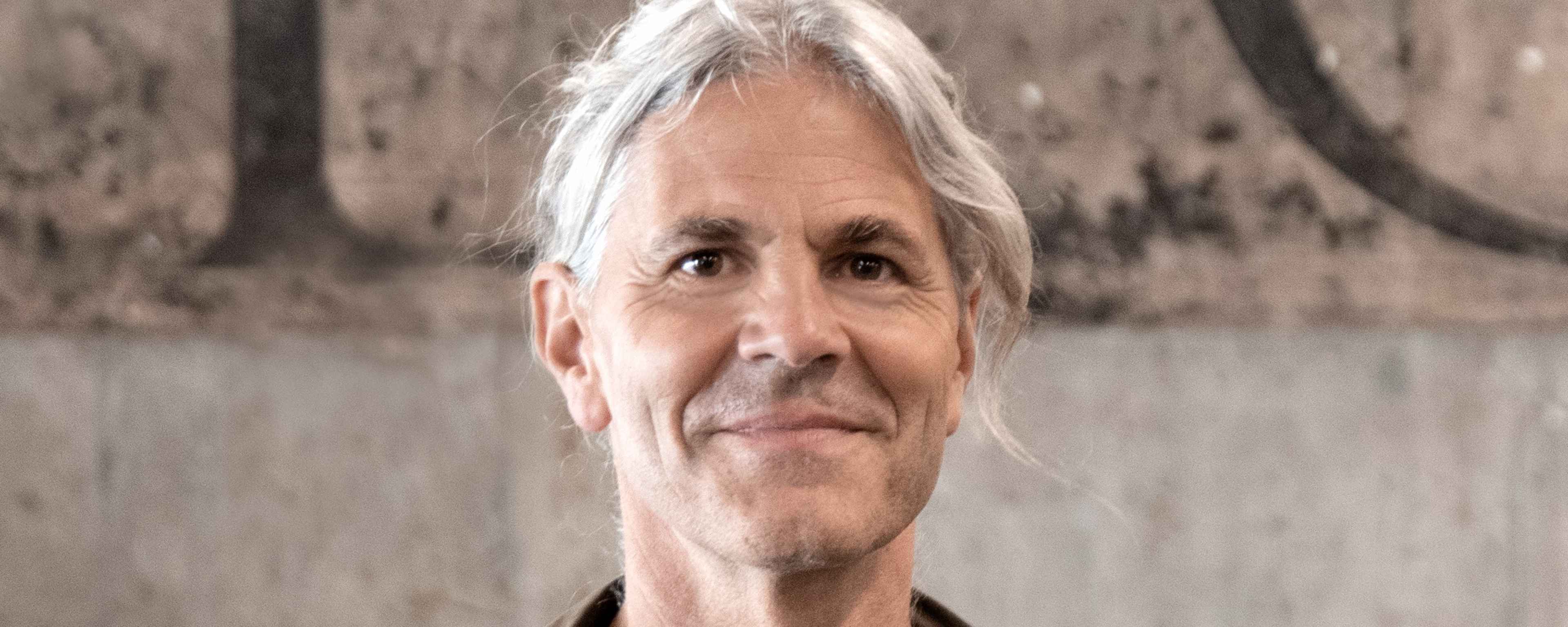

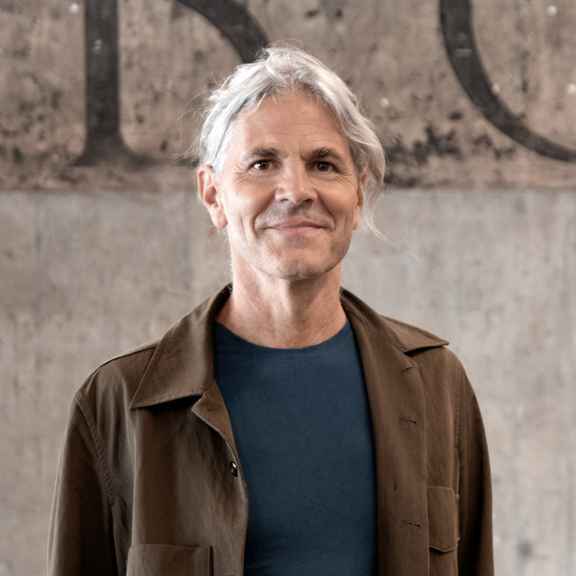

Vielen Dank für den Kommentar!
Zur Veröffentlichung des Kommentars bitte den Link in der E-Mail anklicken.