Wertedebatte im Finanzsektor: Mehr als Wachstum
Der Eröffnungsabend der 12. Fair Finance Week im Haus am Dom stand unter dem Titel „Da war doch was? – Wo sind unsere Werte geblieben?“. Silvia Winkler (GLS Bank) begrüßte die rund 60 Gäste im Haus am Dom, sowie die Teilnehmenden im Livestream. Der Frankfurter Stadtkämmerer und Finanzdezernent Dr. Bastian Bergerhoff betonte in seinem Grußwort die Rolle Frankfurts als internationales Finanzzentrum:
„Wir wollen die Werte weiter hochhalten und einen fairen und nachhaltigen internationalen Finanzmarkt mitgestalten, weil wir daran glauben, dass auch dieser von Fairness und Nachhaltigkeit profitieren kann. Und wir sind überzeugt, dass gerade Frankfurt mit seinen Regulierungsinstitutionen, als einzige Stadt mit zwei Zentralbanken in der ganzen Galaxie und als Netzwerkstadt zwischen der ‚fairen Bubble‘ und der ‚Finance-Bubble‘ eine große Rolle spielen kann.“
Wie fair die Finanzbranche überhaupt sein kann, hinterfragte die Publizistin und taz-Journalistin Ulrike Herrmann in ihrem Impulsvortrag. Sie stellte die These auf, dass es kein grünes Wachstum geben könne, und somit auch keine grüne Rendite. Technologische Lösungen für die Klimakrise würden nicht ausreichen um diese zu lösen. Der heutige Lebensstandard könne nicht mehr gehalten werden. Vielmehr steuere die Gesellschaft mit der Klimakrise zwangsläufig auf ein Schrumpfen der Wirtschaft zu, was in Zukunft überhaupt keine Renditen mehr ermöglichen werde. Herrmann betonte, dass wir jetzt grundlegend etwas gegen die Klimakrise unternehmen müssten.
In der von Philipp Krohn (FAZ) moderierten Podiumsdiskussion reagierten Dr. Kevin Schaefers (cric e.V. – Verein für Ethik und Nachhaltigkeit in der Geldanlage) und Dr. Bastian Bergerhoff kritisch auf Herrmanns Thesen. Schaefers betonte technologische Entwicklungen und politische Steuerungsinstrumente wie den CO₂-Preis und hob hervor, dass die Zukunft offen und Innovation möglich sei. Bergerhoff unterstrich die Bedeutung von Zuversicht, gesellschaftlichem Konsens und schrittweisem Wandel. Diskutiert wurden weiterhin die Rolle von Banken, die Wirkung von Regulierung, die soziale Dimension der Transformation sowie die Notwendigkeit, soziale Härten abzufedern.
Das Publikum brachte Fragen zu Zeithorizonten, globaler Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit ein. Fazit des Abends: Die Herausforderungen sind komplex, und die Debatte um die richtige Balance zwischen Wachstum, Schrumpfung, Innovation und Werten bleibt aktuell. Der Abend endete mit dem Aufruf, den Dialog über die Wertebasis und tragfähige Lösungen fortzuführen.
Toxischer Reichtum: Gefahr für Demokratie und Klima
Der Mittwoch der diesjährigen Fair Finance Week stand ganz im Zeichen der Frage, ob es toxischen Reichtum geben könne und war mit rund 80 Gästen im Haus am Dom sehr gut besucht. Nachdem Stefanie Walter (Triodos Bank) die Gäste begrüßt hatte, eröffnete Moderatorin Heike Leitschuh das Panel mit der Feststellung, dass Reichtum und insbesondere dessen Konzentration in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema sei. Sie lud das Publikum ein, sich mutig mit dem Thema auseinanderzusetzen: „Wer spricht schon gern darüber, wie viel jemand besitzt? Dennoch ist es wichtig, diese Fragen offen zu adressieren – denn zu viel Reichtum in wenigen Händen kann eine Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen.“
Für den fachlichen Impuls sorgte Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Sie stellte zu Beginn die zentrale Frage: „Was ist eigentlich Reichtum – und wer definiert das?“ Eine allgemeingültige Definition gebe es nicht, „meistens sind es die anderen. Ich selbst bin es meistens nicht.“ Karbe-Geßler erklärte, dass sich Vermögens- und Einkommensungleichheit mithilfe des Gini-Koeffizienten messen lassen. Während die Einkommensverteilung in Deutschland „relativ gleich“ sei, liege der Wert für Vermögen bei 0,7 – also eher ungleich. Gründe dafür seien unter anderem die vergleichsweise geringe Eigentumsquote und Zurückhaltung bei Finanzmarktanlagen. Sie verwies zudem auf die besondere Rolle von Familienunternehmen, die über Generationen Vermögen aufbauen und für viele Arbeitsplätze sorgen. Im Zusammenhang mit der Erbschaftssteuer betonte sie: „Es werden Erbschaftssteuern gezahlt und stets und ständig steigend und das nicht nur von Privatleuten, sondern auch von Unternehmen.“
In der Diskussion ging es dann um die globale Dimension von Ungleichheit: Leonie Petersen (Oxfam) machte deutlich, dass Vermögenskonzentration nicht nur soziale und demokratische Risiken birgt, sondern auch massive Auswirkungen auf das Klima hat. Die reichsten 0,1 Prozent der Bevölkerung verursachen ein Vielfaches der CO₂-Emissionen im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. „Es geht nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch um die Verantwortung für unseren Planeten“, so Petersen.
Peter Rese (taxmenow), selbst Unternehmer und durch einen Firmenverkauf zu Vermögen gekommen, schilderte eindrücklich, wie legal und teilweise steuerfrei große Vermögen ins Ausland verschoben werden. Er berichtete von seiner Motivation, sich heute für mehr Steuergerechtigkeit einzusetzen: „Wenn Arbeit und Konsum hoch besteuert werden, Vermögen aber kaum, läuft etwas schief.“
In der weiteren Diskussion standen die Fragen nach Steuergerechtigkeit, Verantwortung der Vermögenden, der Rolle von Familienunternehmen und den Möglichkeiten politischer Regulierung im Fokus. Besonders kontrovers wurde das Verhältnis von privater Philanthropie und staatlicher Umverteilung diskutiert. Das Publikum – vor Ort und online – brachte sich mit Fragen zu Lenkungswirkung von Steuern, Transparenz und neuen Wegen der Umverteilung ein.
Finanzbildung für alle: Schlüssel zu Teilhabe und Nachhaltigkeit
Am Donnerstagabend der Fair Finance Week drehte sich in der Evangelischen Akademie Frankfurt alles um die Frage, wie Finanzbildung in Deutschland zukunftsfähig und gerecht gestaltet werden kann.
Den Impuls des Abends lieferte Raffaela Hofmann, Gründerin der Geldbildungsinitiative POGEBIX und Buchautorin. Sie begann mit einer grundlegenden Reflexion über unser Verhältnis zu Geld: „Viele Menschen fühlen sich im ständigen Vergleich nie genug – egal, wie viel sie besitzen, es reicht nie, weil es immer jemanden gibt, der mehr hat. Die Frage ist: Wann ist genug?“ Für Hofmann bedeutet echte Geldbildung, „den Mangel nicht mit mehr Geld, sondern mit Bewusstsein zu begegnen und mit jedem Euro bewusst zu entscheiden, wie wir die Zukunft gestalten.“
In der Podiumsdiskussion diskutierten neben Hofmann auch Dennis Färber (Hessisches Ministerium der Finanzen), Tobias Söhne (Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung) und Claudia Müller (Female Finance Forum) über Wege, wie Finanzbildung in Deutschland gestärkt und zugleich sozial und ökologisch ausgerichtet werden kann. Dabei wurde schnell klar, wie zufällig und ungleich die finanzielle Bildung derzeit verteilt ist. Claudia Müller brachte es auf den Punkt: „Momentan ist Finanzbildung einfach eine Glückssache. Sie hängt davon ab, in welchem Elternhaus jemand geboren ist. Das sollte meiner Meinung nach nicht so sein, denn finanzielle Bildung ist zu wichtig und grundlegend.“
Dennis Färber betonte die Rolle der Schule, um Grundlagen zu schaffen: „Schule muss Grundlagen und ein ökonomisches Verständnis schaffen. Dazu, kritisches Denken, was ökonomische Zusammenhänge angeht. Und ganz konkret: Wie gehe ich mit meinem eigenen Taschengeld um?“ Tobias Söhne unterstrich die gesellschaftliche Dimension: „An erster Stelle sollte stehen, möglichst viele oder im Idealfall alle jungen Menschen zu erreichen, um ihnen einfach essentielles Wissen zur Teilhabe in unserer Gesellschaft mitzugeben und zumindest zum Teil Chancengerechtigkeit herzustellen.“
Einigkeit bestand im Podium darüber, dass eine werteorientierte Finanzbildung nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch kritisches Denken und nachhaltiges Handeln fördern soll. Auch das Publikum beteiligte sich rege; sowohl im Saal als auch online. Diskutiert wurde über die Integration von Finanzbildung in den Lehrplan, über soziale Gerechtigkeit und die Bedeutung von Transparenz bei Finanzprodukten. Mehrfach wurde der Wunsch nach unabhängigen, praxisnahen Informationsangeboten laut.
Ein Schritt Richtung mehr Nachhaltigkeit im Finanzwesen
Die Fair Finance Week hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, zentrale Zukunftsfragen des Finanzwesens nicht nur dem Branchendialog zu überlassen, sondern offen und breit in die Gesellschaft zu tragen. Als Ergänzungsprogramm zur Euro Finance Week richtet sich die Fair Finance Week gezielt an die breite Öffentlichkeit und wirbt für einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, Teilhabe und Verantwortung im Finanzsystem. Die Vielfalt der Perspektiven, der konstruktive Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie die kostenfreien, non-profit-orientierten Veranstaltungen machen deutlich: Nur gemeinsam und auf Basis von Werten, Gerechtigkeit und Bildung kann eine zukunftsfähige Finanzwelt entstehen. Die Fair Finance Week bleibt damit ein wichtiger Impulsgeber für eine faire Transformation; und das weit über die Finanzmetropole Frankfurt hinaus.














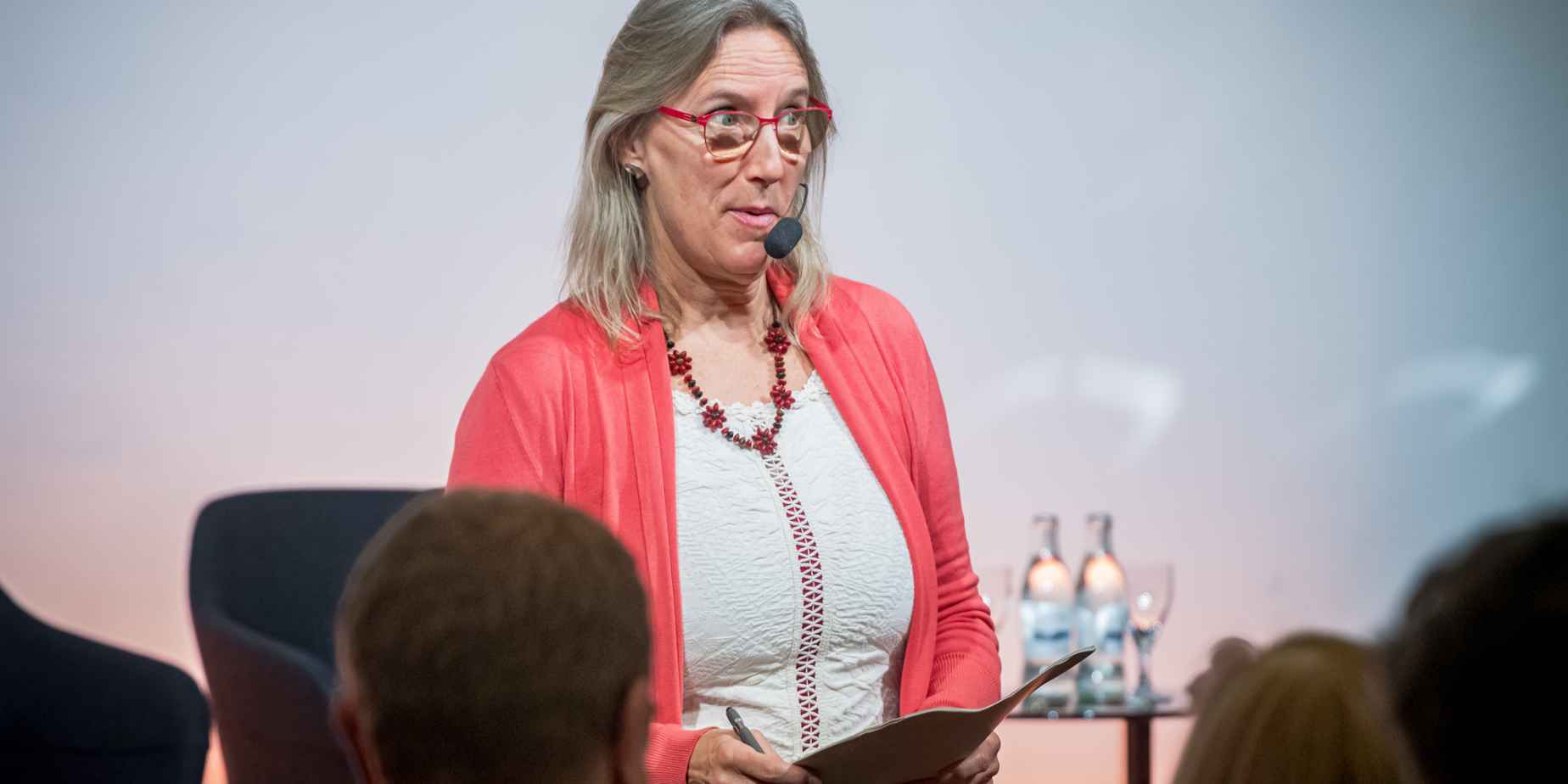








Vielen Dank für den Kommentar!
Zur Veröffentlichung des Kommentars bitte den Link in der E-Mail anklicken.